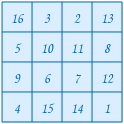Anne Will und Claus Kleber machen es, Audi und Otto machen es, die taz und Krautreporter machen es ebenfalls: Seit einigen Monaten hat die Diskussion um das Gendern, also die sprachliche Kombination von männlich, weiblich und divers, neuen Schub bekommen. Warum ich dennoch weiter ohne Sternchen schreibe.
Worum geht es überhaupt?
Der Begriff „gendern“ wird nicht einheitlich verwendet. Die meisten verstehen darunter eine geschlechtergerechte Sprache, bei der durch einen Großbuchstaben oder ein Sonderzeichen mitten im Wort Menschen jedweden Geschlechts – männlich, weiblich, divers – zusammengefasst werden. Beispiele: „EinwohnerInnen“ (Binnen-I), „Einwohner_innen“ (Gendergap), „Einwohner*innen“ (Gendersternchen), „Einwohner:innen“, „Einwohnerïnnen“. Im weiteren Sinne werden aber auch Doppelnennungen („Kolleginnen und Kollegen“) oder neutrale Formulierungen („Pflegekräfte“) darunter gefasst. Das generische Maskulinum, bei dem die männliche Form alle Geschlechter umfasst („Die Stadt hat 5 Mio. Einwohner“), gilt den meisten Verfechtern einer geschlechtergerechten Sprache gerade nicht als geschlechtergerecht. Die Vielzahl der sprachlichen Möglichkeiten zeigt sich eindrucksvoll in einer Wikipedia-Umfrage vor zwei Jahren (dort ist es am Ende aber beim generischen Maskulinum geblieben).
Was ist das Ziel?
Ursprünglich ging es beim Gendern nur um das Verhältnis von Männern und Frauen. Der feministischen Sprachkritik zufolge diskriminiert die Sprache Frauen. Beim generischen Maskulinum würden Frauen höchstens mitgemeint, aber nicht explizit angesprochen. Dementsprechend wurden zunächst Doppelnennungen befürwortet. Im Extremfall sprachen sich die Feministinnen für das generische Femininum aus, also die Verwendung weiblicher Formen, bei denen Männer mitgemeint sein sollen. Vorgeschlagen wurde es bereits Mitte der Achtzigerjahre von Luise F. Pusch.
Im Jahr 2013 wurde die Grundordnung der Universität Leipzig [Link] vollständig im generischen Femininum verfasst. In einer Fußnote heißt es: „In dieser Ordnung gelten grammatisch feminine Personenbezeichnungen gleichermaßen für Personen männlichen und weiblichen Geschlechts. Männer können die Amts- und Funktionsbezeichnungen dieser Ordnung in grammatisch maskuliner Form führen.“ Im Text selbst finden sich nun Sätze wie der folgende: „Die Vertreterinnen der Gruppe der Hochschullehrerinnen, der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und der Gruppe der sonstigen Mitarbeiterinnen in den Fakultätsräten, die Dekaninnen, Prodekaninnen und Studiendekaninnen sowie die Gleichstellungsbeauftragten werden für eine dreijährige Amtszeit gewählt.“ Also ausgleichende Gerechtigkeit. Immerhin ist der Gleichstellungsbeauftragte der Uni Leipzig ein Mann. [Liste der Beauftragten der Uni Leipzig, abgerufen am 10.04.2021]
Es gibt im Verhältnis von Männern und Frauen bereits zwei Richtungen. Den einen ist es wichtig, dass Frauen immer explizit mitgenannt werden. Den anderen reicht es, wenn das generische Maskulinum vermieden wird.
Manche Frauen finden dagegen die weiblichen Formen an sich diskriminierend. Insbesondere ein Beitrag von Nele Pollatschek, einer Schriftstellerin, die sich selbst als Schriftsteller bezeichnet, hat eine Menge Resonanz erfahren. [Tagesspiegel 30.08.2020] Aus Ihrer Sicht ist das Geschlecht keine Eigenschaft, die ständig mitgenannt werden muss. In einer Talkshow hat sie sich später für Abschaffung der sprachlichen Geschlechter ausgesprochen. [Focus 11.03.2021] Sie stellt sich allerdings gegen die meisten Gegner des Genderns („piefige Konservative von Welt“, die „sowieso gegen das Gendern sind“) und findet: „Menschen, die Gendern sind grundsympathisch“ [Tagesspiegel 30.08.2020, Rechtschreibfehler im Original]. Bemerkenswert, wenn man im Kampf für integrierende Sprache selbst Vorurteile schürt.
Es gibt eine dritte Gruppe, nämlich Diverse, also Personen, die sich weder als männlich noch als weiblich sehen. Dementsprechend sehen sie sich auch sprachlich weder durch die männliche noch durch die weibliche Form vertreten und dürften das Gendern durchweg befürworten oder fordern. Allerdings gibt es auch in diesem Personenkreis keine Einigkeit darüber, welche Variante des Genderns bevorzugt wird, also beispielsweise Gendergap oder Gendersternchen. Wie individuell es werden kann, zeigt sich bei der Verwendung des Pronomens im Singular: Einige bevorzugen „er“ oder „sie“, andere möchten „er_sie“ oder „er*sie“ genannt werden [Autorenprofil Gabriel_Nox Koenig beim Umrast-Verlag, abgerufen am 10.04.2021], und wieder andere fordern ein ganz eigenes Pronomen. So bevorzugt Lann Hornscheidt das Pronomen „ens“, alternativ auch „ex“ [persönliche Internetseite, abgerufen am 10.04.2021], während Blu Doppe als Pronomen „blu“ wünscht [Autorenprofil Unrast-Verlag, abgerufen am 10.04.2021].
Es gibt also kein einheitliches Ziel. Es gibt nicht einmal eine Mehrheit für das Gendern an sich. [Galileo 25.03.2021, Zeit 26.02.2021, Welt 31.05.2020, t-online 25.01.2019]
Von Anreden, Stellenanzeigen und Studien
Am wichtigsten ist das Thema vermutlich bei Anreden. In einer Mail an Männer und Frauen im eigenen Unternehmen nur „Liebe Kollegen“ zu schreiben, dürfte den Frauen gegenüber unhöflich sein, da das generische Maskulinum von vielen von ihnen abgelehnt wird. Ich schreibe „Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen“, was mir deutlich höflicher erscheint als „Liebe Kolleg:innen“. Bei der Anrede möchte ich so spezifisch wie möglich sein – zusammenfassen nur, soweit es die Größe des Verteilers erfordert. Wäre eine diverse Person im Verteiler, würde die Doppelnennung „Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen“ allerdings nicht reichen.
Aber wie sieht es im Text aus? Oftmals wird auf Studien verwiesen, die zeigen sollen, dass sich Frauen beim generischen Maskulinum nicht angesprochen fühlen. Hierbei geht es sehr häufig um Berufe im Allgemeinen und um Stellenanzeigen im Besonderen. Ich denke, in diesem Bereich steht es außer Frage: Wenn „ein Teamleiter“ gesucht wird, bewerben sich Frauen seltener, als wenn „eine Teamleiterin oder ein Teamleiter“ gesucht wird. Allerdings wird es solche Effekte auch bei anderen Eigenschaften als dem Geschlecht geben: Auch Menschen mit Migrationshintergrund, jüdische oder muslimische Menschen, Menschen mit Behinderung oder Menschen mit Adipositas könnten vorschnell zu dem Schluss kommen, dass sie bei einer konkreten Stelle in einem konkreten Unternehmen keine Chance haben. Das spricht dafür, auch hierzu klarstellende Regelungen in Stellenanzeigen aufzunehmen.
Aber kann man aus der Reaktion auf Stellenanzeigen folgern, dass auch außerhalb dieses Bereiches alle Sätze durchgegendert werden müssen? Ich meine nein. Es wird niemandem wehtun, wenn ich weiterhin zum Bäcker gehe, sogar dann, wenn dort eigentlich eine Bäckerin oder nur noch ein Brotbackautomat tätig ist. Und wenn ich in Not nach einem Arzt rufe, wird vermutlich keine Ärztin untätig bleiben, nur weil ich sie nicht mitgenannt habe. Manchmal sind die Bezeichnungen so abstrakt, dass man ohnehin keinen Menschen mehr vor Augen hat: Wem nützt es, vom Fahrer:innensitz zu sprechen?
Das heißt, legitime Ziele des Gendern sind aus meiner Sicht Höflichkeit und Chancengerechtigkeit. Wenn ich einen Käufer für mein altes Auto suche, dürfte sich keine Frau diskriminiert fühlen. Die Aussage, dass ein Unternehmen 200 Mitarbeiter hat, ist aus meiner Sicht unproblematisch, weil niemand auf den Gedanken kommt, es handele sich nur um Männer. Wenn man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dagegen stärker an den Entscheidungsprozessen beteiligen möchte, sollte man das generische Maskulinum sicher eher meiden – es könnte missverstanden werden.
Wie können die Ziele sprachlich erreicht werden?
Um alle Geschlechter sichtbar zu machen, kann man die bereits eingangs angeführten Beispiele des Genderns nutzen: „EinwohnerInnen“, „Einwohner_innen“, „Einwohner*innen“, „Einwohner:innen“, „Einwohnerïnnen“. Man kann sich aber auch für Doppelnennungen entscheiden („Einwohnerinnen und Einwohner“). Oder man verwendet neutrale Begriff („Lehrkräfte“, „Führungskräfte“). Auch substantivierte Partizipien werden gerne als Möglichkeit der genderneutralen Sprache angeführt („Studierende“). Alternativ können Sätze auch so umformuliert werden, dass die Substantive gar nicht mehr benötigt werden.
Mischt man alle diese Varianten, so werden aber auch die Ziele vermischt: Möchte man nun betonen, dass alle Geschlechter angesprochen sind, oder möchte man das Geschlecht unsichtbar machen? Die meisten, die in letzter Zeit angefangen haben zu gendern, scheinen sich nicht festlegen zu wollen und wechseln zwischen Hervorheben und Unsichtbarmachen hin und her. Geht es am Ende doch nur einzig und allein darum, das generische Maskulinum zu eliminieren?
Wo liegen die sprachlichen Unklarheiten?
Zunächst ist völlig unklar, welche der vielen vorgeschlagenen Varianten am ehesten verwendet werden sollten. Binnen-I und Gendersternchen scheinen in der Häufigkeit das Rennen zu machen. Manche bevorzugen den Gendergap, um hervorzuheben, dass eine Pause beim Sprechen gemacht werden soll [BdKom, Kompendium Gendersensible Sprache, Strategien zum fairen Formulieren, S. 32], andere verwenden den Doppelpunkt, weil er den Lesefluss weniger stört [Krautreporter 25.01.2021]. Also was nun: Die Lücke betonen oder kaschieren?
Außerdem kann man das Gendersternchen oder die anderen Varianten moderat oder extrem einsetzen. Extreme Varianten, die von manchen vermieden und eher durch Doppelnennungen oder Umformulierungen ersetzt werden:
- Verlust der männlichen Form wie beim Begriff „Ärzt*in“ (der Arzt kann nicht mehr herausgelesen werden);
- unklare grammatische Zuordnung wie bei „ein*e Beauftragte*r“ (beim Artikel kommt zunächst die männliche, beim Hauptwort erst die weibliche Form);
- Kopplung ganzer Wörter durch Sternchen wie in „er*sie“ oder „der*die Beauftragte“;
- Ersetzung von „man“ durch „man*frau“.
Es gibt keinerlei Konsens darüber, welche dieser Formen verwendet werden sollten und welche nicht. Es gibt keinerlei gemeinsames Regelwerk.
Alles gendern, was zu gendern geht?
Wenn Menschen sich erst für das Gendern entschieden haben, kann sie nichts mehr stoppen. Alle Sprachregeln scheinen aufgehoben. Da werden „Mitglieder*innen“ angesprochen, und vielen fällt nicht einmal mehr auf, dass „das Mitglied“ schon geschlechtsneutral ist. Die „Vorständin“ steht schon länger, die „Gästin“ erst seit kurzem im Duden. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die „Menschin“ gesellschaftsfähig wird. Werde ich dann zu einem „Personer“?
Es gibt aber auch subtilere Fälle. Mein Arbeitgeber gendert Kunden zu „Kund:innen“. So weit, so gut. Allerdings sind unsere Kunden ausschließlich Unternehmen. Ob eine Bank oder Versicherung sich als Kundin bezeichnen würde? Noch merkwürdiger erscheint mir die Vorstellung, dass eines unserer Kundenunternehmen sich weder als männlich noch als weiblich sieht. Gibt es auch Unternehmen, die agender oder genderfluid sind?
In einem Artikel eines journalistischen Portals bin ich vor einiger Zeit über „Wirt:in“ gestolpert. Auf den ersten Blick nicht ungewöhnlich, sondern sauber gegendert. Allerdings ging es um mögliche Wirte für den Coronavirus. Das können auch Tiere sein. Bei jedem Tier, egal ob männlich oder weiblich, würden wir von einem Wirt sprechen. Nur bei Menschen unterscheiden wir nach dem Geschlecht? Wenn eine Frau den Virus in sich trägt, ist sie die „Wirtin“ dieses Virus? Ich stelle mir unweigerlich eine Frau vor, die dem Virus im Hofbräuhaus ein Weißbier serviert.
Nach meinem Sprachgefühl gibt es Begriffe, die von vornherein weniger stark das Gendern herausfordern als andere. Die Anrede „Liebe Kollegen“ wird heutzutage niemand mehr verwenden, wenn auch Frauen im Verteiler sind. (In der Praxis habe ich es zuletzt doch noch vereinzelt gesehen, aber ausschließlich, wenn Frauen die Mail geschrieben haben.) Andere Begriffe rufen weniger stark danach, gegendert zu werden. Vor Jahren war ich überrascht, dass bei meiner Berufsbezeichnung „Aktuar“ eine weibliche Form „Aktuarin“ eingeführt wurde. Mir erschien der Begriff immer schon geschlechtsneutral.
Und dann ist da noch der Key Account Manager, der auch schon mal gegendert wird: Key Account Manager*in. Nur ist die Wortgruppe Key Account Manager ja von vorne bis hinten englisch und damit schon geschlechtsneutral. Halt, werden manche einwenden, das Wort Manager ist doch schon längst eingedeutscht. Meinetwegen, aber wenn der Begriff Key Account Manager als deutsche Wortgruppe mit englischen Bestandteilen angesehen wird, fehlt doch etwas. Richtig: Der Bindestrich, den leider auch niemand mehr verwenden mag. (Beim Key Account Manager fehlten dann übrigens sogar zwei Bindestriche.)
Die substantivierten Partizipien machen es meistens nicht besser. Da werden aus Mitarbeitern des Unternehmens schnell „Mitarbeitende des Unternehmens“ – müssten es nicht „im Unternehmen Mitarbeitende“ sein? Und was ist, wenn diese Personen rechtlich zwar Mitarbeiter sind, aber gar nicht mitarbeiten, beispielsweise weil sie langzeitkrank sind? Sind es dann „nicht mitarbeitende Mitarbeitende“?
Vereinzelt wurden auch schon „Sozialarbeitende“ gesichtet. Sind das nicht eher „sozial Arbeitende"? Wobei „sozial Arbeitende“ ja nicht unbedingt „Sozialarbeiter“ sein müssen.
Und ganz merkwürdig wird es, wenn man sich so an die Partizipien gewöhnt hat, dass man sie auch im Singular beibehält und folgerichtig das Gendersternchen verwendet: „ein*e Studierende*r“. Warum dann nicht gleich „ein*e Student*in“?
Wie sieht es mit den Regeln aus?
Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat die Aufgabe, „die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen Sprachraum zu bewahren und die Rechtschreibung auf der Grundlage des orthografischen Regelwerks im unerlässlichen Umfang weiterzuentwickeln.“ [Rat für deutsche Rechtschreibung, abgerufen am 10.04.2021] Es handelt sich um ein zwischenstaatliches Gremium, in dem deutschsprachige Länder und Regionen vertreten sind. Der Rat ist legitimiert, ein amtliches Regelwerk herauszugeben.
Erst kürzlich hat der Rat erneut über das Gendern diskutiert. Er bekräftigt das Anliegen einer geschlechtergerechten Sprache, spricht sich aber gegen die Verwendung der verkürzenden Formen mit Gendergap, Gendersternchen oder Doppelpunkt aus: „Ihre Nutzung innerhalb von Wörtern beeinträchtigt daher die Verständlichkeit, Vorlesbarkeit und automatische Übersetzbarkeit sowie vielfach auch die Eindeutigkeit und Rechtssicherheit von Begriffen und Texten. Deshalb können diese Zeichen zum jetzigen Zeitpunkt nicht in das Amtliche Regelwerk aufgenommen werden.“ [Rat für deutsche Rechtschreibung 26.03.2021, Pressemitteilung]
Das Gendern ist in der Standardsprache also noch gar nicht angekommen. Es entspricht nicht dem Regelwerk. Nur wenige Tageszeitungen verwenden es, die großen Leitmedien gendern nicht. Ich habe noch nie einen gegenderten Roman gelesen (bin aber sicher, dass es welche gibt). Im Lexikon wird üblicherweise das generische Maskulinum verwendet. Und im täglichen Gebrauch kommt das Gendern ebenfalls kaum vor. Ich glaube auch nicht, dass es sich dort durchsetzen wird. Auch in zehn Jahren werde ich noch sagen: „Ich gehe mal kurz zum Bäcker.“
Neue Diskriminierungen
Viele, die sich zuletzt für das Gendern speziell mittels Doppelpunkt entschieden haben, haben vor allem zwei Argumente angeführt.
Das eine lautet, dass es den Sprachfluss weniger stört als Gendergap oder Gendersternchen. Also wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass.
Das andere ist gravierender: Angeblich ist der Doppelpunkt barrierefrei. Krautreporter schreibt: „Und drittens trägt der Doppelpunkt auch zu Barrierefreiheit bei: Screenreader, die von blinden Menschen benutzt werden, um sich Artikel vorlesen zu lassen, machen beim Doppelpunkt automatisch eine kleine Pause – genauso, wie es auch in der gesprochenen Sprache üblich ist.“ [Krautreporter 25.01.2021, abgerufen am 10.04.2021] Ähnliche Begründungen findet man auch an anderen Stellen im Netz.
Nur: Das Argument stimmt nicht.
Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband schreibt: „Der Doppelpunkt steht auf einer Liste nicht empfohlener Gender-Kurzformen des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes. Gründe sind Probleme beim Vorlesen – sei es durch einen Computer oder durch eine Person – und bei der Darstellung in Blindenschrift. Trotzdem wird der Doppelpunkt zunehmend als eine besonders blinden- und sehbehindertenfreundliche Form des Genderns dargestellt. Grund ist vermutlich die Annahme, dass der Doppelpunkt von Screenreadern standardmäßig nicht vorgelesen werde, weil er im Gegensatz zu Stern und Unterstrich kein Sonderzeichen, sondern ein Interpunktionszeichen ist. Abgesehen davon, dass dies von den Screenreadern unterschiedlich gehandhabt wird, hat der Doppelpunkt jedoch wichtige Funktionen, weshalb viele blinde und sehbehinderte Menschen ihn sich vorlesen lassen. Das Unterdrücken des Doppelpunktes führt zudem zu einer längeren Pause als das Unterdrücken anderer Zeichen. So kann der Eindruck entstehen, der Satz sei zu Ende.“ [DBSV, abgerufen am 10.04.2021]
Barrierefreiheit betrifft im Übrigen nicht nur Menschen mit einer Sehbehinderung. Auch Personen, die kognitiv nur eine einfache Sprache verstehen, werden durch das Gendern beeinträchtigt. Menschen sind nicht behindert, sie werden behindert. Manchmal eben auch durch gegenderte Sprache.
Im Übrigen: Wer sagt denn eigentlich, dass ich mich als Mann bei der Anrede „Liebe Kolleg:innen“ angesprochen fühle? „Kolleg:innen“, das ist doch der Plural von „Kolleg:in“, also alles außer Männer?! Und gesprochen ersparen sich viele ohnehin die Pause und den Glottisschlag, und dann höre ich nur noch das generische Femininum.
Nur für die Elite?
Es geht nicht nur ums Verstehen, es geht auch ums Schreiben und Sprechen. Gegenderte Sprache, die sich außerhalb der Standardsprache bewegt und keinerlei einheitliche Regeln hat, ist deutlich schwerer zu schreiben und zu sprechen. Oben habe ich schon ein Beispiele angeführt, die zeigen, wie man am Gendern scheitern kann, beispielsweise bei den „Mitglieder*innen“. Wer Geisteswissenschaften studiert, denkt vielleicht, dass die ganze Welt gendert. Aber außerhalb des universitären Kosmos ist das tatsächlich nicht der Fall. Meine Friseurin würde mich vermutlich groß ansehen, wenn ich von „Friseur*innen“ sprechen würde. Sie würde mich vielleicht korrigieren und sagen, es heiße „Friseur-Innung“.
Ich habe den Verdacht, dass es manchen Befürwortern des Genderns sogar eigens darum geht, sich von anderen abzuheben. Wer gendert, gehört zu den Guten. Dabei handelt es sich ohnehin um einen Trend im Zeitalter der sozialen Medien: Keine Blutspende, ohne dass ein Selfie davon auf mindestens drei Kanälen veröffentlicht wird. Und mit dem Gendern zeigt man auch außerhalb der sozialen Medien, wofür man steht.
Manchen mag es auch darum gehen, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele Lorbeeren zu verdienen: „Ich gendere doch schon, da muss ich mich nicht auch noch um den Gender Pay Gap kümmern.“
Zum Glück sind die meisten, die gendern, eher pragmatisch und verwenden zwischendurch immer mal wieder das generische Maskulinum. Wie letztens eine Kollegin bei einem Rollenspiel in einer Weiterbildung: „Jetzt möchte ich mal Kandidat sein.“
Was wäre, wenn?
Das Gendern hat eine Jahrzehnte lange Vorgeschichte. Was wäre, wenn die Feministinnen der ersten Stunde nicht gefordert hätten: „Nennt die Professorinnen explizit mit“, sondern wenn sie stattdessen gesagt hätten: „Nennt mich nicht Professorin, ich bin ein vollwertiger Professor“? Wenn sie nach und nach die weiblichen Berufsbezeichnungen eliminiert hätten, wie sie das Wort Fräulein erfolgreich eliminiert haben? Wenn uns immer deutlicher bewusst gemacht worden wäre, dass das generische Maskulinum Männer und Frauen umfasst (und eben auch Personen, die sich nicht als männlich oder weiblich sehen)? Wenn wir aus dem grammatischen Geschlecht keinerlei Schlussfolgerungen mehr ziehen würden?
Utopisch?
Vor mehreren Jahren habe ich vor meinem Urlaub ein paar Brocken Norwegisch gelernt. Das Norwegische ist dem Deutschen in vielerlei Hinsicht ähnlich. In einer der ersten Lektionen bin ich über die folgende Passage gestolpert: „Weibliche Endungen wie -inne -in waren früher verbreitet, werden jetzt aber als eher altmodisch eingestuft. Im Laufe der zunehmenden Gleichberechtigung in Norwegen wurde es immer üblicher, auch sprachlich keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu machen. Wollen Sie trotzdem verdeutlichen, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt, stehen die Adjektive kvinnelig weiblich und mannlig männlich zur Verfügung“. [Eldrid Hågård Aas, Praktisches Lehrbuch Norwegisch, Langenscheidt 2009, S. 22]
Es geht also. Statt das generische Maskulinum zu verdammen, hätten es sich die Frauen zu eigen machen können, so wie sich Homosexuelle die Wörter „schwul“ und „lesbisch“ zu eigen gemacht haben. Das wäre vermutlich erfolgreicher gewesen als die jahrzehntelangen Diskussionen um das richtige Gendern. Und Personen, die sich weder als männlich noch als weiblich verstehen, müssten auch nicht fürchten, nicht gemeint zu sein.
Letztlich löst das Gendersternchen also ein Problem, das die Feministinnen mit der Bekämpfung des generischen Maskulinums erst geschaffen haben.
Zugegeben: Viele Rollen, die heute von Personen jedweden Geschlechts wahrgenommen werden können, betrafen früher fast ausschließlich Männer. Wer daraus schließt, dass das generische Maskulinum erst eine Erfindung der Achtzigerjahre war, als sich Berufe langsam auch Frauen öffneten [Volksverpetzer 10.03.2019], verkennt aber, dass es nicht nur um Berufe und Ämter geht. Um nur ein Beispiel zu nennen: Auch Goethe sprach im Faust schon von „Patienten“, sicherlich ohne sich dabei auf Männer beschränken zu wollen („Hier war die Arzeney, die Patienten starben, Und niemand fragte: wer genas?“).
Alle Probleme wären mit dem generischen Maskulinum natürlich nicht gelöst. Es gäbe ja weiterhin geschlechtsspezifische Artikel, Attribute und Pronomen. Aber es wäre schon einiges einfacher, denn auch das Gendersternchen löst ja nicht alle Probleme.
Bitte keine Sprachpolizei!
Ein Problem mit dem Gendern habe ich vor allen Dingen, wenn mir vorgeschrieben wird, wie ich zu schreiben oder zu sprechen habe.
Ulrike Winkelmann, eine von zwei Chefredakteurinnen der taz, schrieb in ihrem lesenswerten Artikel: „Wenn es aber von oben nach unten geht, also als Vorgabe daherkommt, liegt die Sache anders. In dem Augenblick verlässt die emanzipative Sprachpolitik den charmanten Bereich des Experiments, sie wird gemessen mit dem Maßstab für andere Sprachpolitiken mit Herrschaftsanspruch.“ [taz undatiert, abgerufen am 10.04.2021]
Und es wird in der Tat versucht, anderen vorzugeben, wie sie zu schreiben oder zu sprechen haben. Oft erfolgen die Vorgaben subtil, indem suggeriert wird: Wer nicht gendert, grenzt aus. Wer nicht gendert, gehört zu den alten weißen Männern, die ohnehin Teil des Problems sind.
Es kann aber auch konkreter werden. Der Duden hat beispielsweise den Ruf, maßgebend in Zweifelsfällen der deutschen Rechtschreibung zu sein. Diese Rolle hat er allerdings schon seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Aber der Ruf gibt Macht, und die wird durchaus ausgenutzt. So wird „der Einwohner“ im Duden neuerdings definiert als „männliche Person, die in einer Gemeinde, einem Land ihren ständigen Wohnsitz hat“ – ganz so, als gäbe es gar kein generisches Maskulinum. Die Chefredakteurin Kathrin Razum-Kunkel streitet diese Zielrichtung zwar ab [Zeit 29.01.2021], aber im Duden steht es jetzt erst einmal. Wer dort nachschlägt, bekommt eine eindeutige Antwort: Einwohner, das können nur Männer sein.
Der Grundstein dieser Sichtweise wird an den Hochschulen gelegt. Wer im Studium nicht gendert, muss mit schlechteren Noten rechnen, besonders im Bereich der Geisteswissenschaften. Ein Beispiel ist die Uni Kassel, wo das Thema gerade durch die lokale Presse ging. [HNA 01.04.2021] An anderen Unis dürfte es ebenso aussehen. Wer Geisteswissenschaften studiert hat, ist damit schon deutlich zum Gendern erzogen worden.
Das Gendern ist der Anfang. Auch in anderen Bereichen, in denen es um Diskriminierung geht, werden sprachliche Veränderungen gefordert. Es ist legitim, wenn Menschen in der Rassismusdebatte über „Schwarze Menschen“ (schwarz großgeschrieben) und „weiße Menschen“ (weiß kursiv geschrieben) schreiben. Es ist m. E. aber anmaßend, das auch anderen vorschreiben zu wollen, wie es durchaus geschieht [z. B. @FerdaAtaman auf Twitter 11.06.2020, abgerufen am 10.04.2021].
Ich glaube, dass ein solches Vorgehen dem angestrebten Ziel, nämlich dem Abbau von Diskriminierungen, eher schadet als nützt. Wenn mir oberlehrerhaft vorgegeben wird, wie ich zu schreiben oder zu sprechen habe, dann werde ich mich in bestimmten Kontexten vielleicht nicht mehr äußern oder mit bestimmten Menschen nicht mehr sprechen. Viel wichtiger, als permanent politisch korrekt zu sprechen, ist es aber doch, überhaupt miteinander zu sprechen.
Aber Sprache hat sich schon immer verändert!
Eines der Argumente, die immer wieder für das Gendern vorgebracht werden, ist: Sprache hat sich schon immer verändert. Das ist inhaltlich richtig, aber als Argument falsch. Wir sprechen ja derzeit nicht davon, dass die Sprache sich verändert, sondern dass bestimmte Gruppen die Sprache verändern möchten.
Es gibt ein Beispiel, wie Sprache sich verändert, das ich sehr bewusst verfolgt habe: Es geht um die Wendung „es macht Sinn“. Im Deutschen ergeben Dinge Sinne, manchmal haben sie einen tieferen Sinn, aber Sinn wird normalerweise nicht gemacht. Bastian Sick, der bekannte Gegner jeglicher Sprachveränderung, hat sich vor knapp zwei Jahrzehnten prominent gegen diesen Anglizismus geäußert. [Bastian Sick 20.08.2003] Ich habe mich lange dagegen gewehrt, diese Wendung auszusprechen, aber da man permanent damit konfrontiert wird, ist sie oft schneller verfügbar als andere Formen. Ich sage daher mittlerweile auch häufiger, dass etwas keinen Sinn macht.
Das ist meines Erachtens ein wichtiger Punkt bei der Veränderung der Sprache: Das Neue wird schneller verfügbar, einfacher, flüssiger, melodischer oder reimt sich besser, und deshalb verbreiten sich bestimmte neue Wörter und Wendungen wie ein Virus. Man hört es von anderen und wird angesteckt.
Das Gendern macht die Sprache dagegen schwerer, weniger flüssig und unmelodisch. Es hat sich daher die letzten Jahrzehnte nicht durchsetzen können und wird sich vermutlich auch in Zukunft nicht durchsetzen, jedenfalls nicht von alleine. Hätte sich die Feministinnen das generische Maskulinum zu eigen gemacht, wäre es vermutlich einfacher gewesen, aber das Gendern mit Sternchen lässt sich nur durch Verordnung umsetzen. Lassen wir der Sprache ihren freien Lauf, so wird das Gendern da bleiben, wo es immer noch ist: In einer Nische.
Kein Applaus von der falschen Seite!
Besonders die AfD und ihre Anhänger fallen immer wieder dadurch auf, dass sie gegen das Gendern wettern. Das sollte aber nicht zum Umkehrschluss führen, dass die Gegner des Genderns durchweg rechts stehen.
Der Verein Deutsche Sprache hat 2019 geschrieben: „Also appellieren wir an Politiker, Behörden, Firmen, Gewerkschaften, Betriebsräte und Journalisten: Setzt die deutsche Sprache gegen diesen Gender-Unfug wieder durch!“ [VDS 06.03.2019] Und aktuell heißt es dort: „Rettet die deutsche Sprache vor dem Duden“ – mit bereits 35.000 Unterzeichnern. [VDS undatiert, abgerufen am 10.04.2021]
Der Verein Deutsche Sprache dürfte Rechtspopulisten nahestehen. [zusammengefasste Kritik auf Wikipedia] Das ändert aber nichts daran, dass die Unterschriften unter den Aufrufen aus allen politischen Lagern kommen. Wolfgang Thierse dürfte einer der prominentesten Unterstützer des aktuellen Aufrufs sein, und in der Liste der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner finden sich viele weitere Personen, die nicht im Verdacht stehen, eine rechte Gesinnung zu haben.
Was mir meine Entscheidung gegen das Gendern etwas schwerer macht: Ich bekomme möglicherweise Applaus von der falschen Seite. Allerdings unterscheide ich mich in einem Punkt von den Rechten: Ich lehne nur bestimmte Formen des Genderns ab und verwende durchaus Doppelnennungen oder neutralen Umschreibungen.
Mein Fazit
Ich unterstütze die Ziele, die der Rat für deutsche Rechtschreibung aufgestellt hat, vollumfänglich: „Geschlechtergerechte Texte sollen sachlich korrekt sein, verständlich und lesbar sein, vorlesbar sein (mit Blick auf die Altersentwicklung der Bevölkerung und die Tendenz in den Medien, Texte in vorlesbarer Form zur Verfügung zu stellen), Rechtssicherheit und Eindeutigkeit gewährleisten, übertragbar sein im Hinblick auf deutschsprachige Länder mit mehreren Amts- und Minderheitensprachen (Schweiz, Bozen-Südtirol, Ostbelgien; aber für regionale Amts-und Minderheitensprachen auch Österreich und Deutschland), für die Lesenden bzw. Hörenden die Möglichkeit zur Konzentration auf die wesentlichen Sachverhalte und Kerninformationen sicherstellen.“ [Rat für deutsche Rechtschreibung 26.03.2021, Pressemitteilung]
Ergänzen muss man noch: Sie muss barrierefrei sein. Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband schreibt: „Bisher gibt es unter den Menschen, die sich weder als männlich noch als weiblich einordnen, keinen Konsens darüber, wie gegendert werden soll. Wenn sich jedoch die maßgeblichen Organisationen dieser Menschen auf einen gemeinsamen Vorschlag dazu einigen würden, wäre das für uns ein gewichtiger Grund, unsere Position zum Gendern auf den Prüfstand zu stellen – schließlich sind auch wir eine Selbsthilfevereinigung und respektieren deshalb, wenn Menschen in eigener Angelegenheit entscheiden wollen.“ [DBSV, abgerufen am 10.04.2021] Dem möchte ich mich anschließen.
Wenn sich eine geeignete Lösung in der Standardsprache herausbilden sollte, die die angeführten Kriterien zumindest in wesentlichen Teilen erfüllt, dann werde ich meine Meinung noch einmal überdenken. Bis dahin schreibe ich eher konservativ. Ich möchte, dass der Inhalt meiner Texte verstanden wird und die Leserinnen und Leser nicht ständig über ein Gendersternchen oder ein missglücktes Partizip stolpern. Also verwende ich Doppelnennungen, neutrale Formulierungen und manchmal eben auch das generische Maskulinum. Und falls ich einmal eine Person kennenlerne, die sich nicht mit „er“ oder „sie“ identifizieren kann, werde ich das berücksichtigen. Aber dafür muss ich nicht auf Vorrat vollständige Texte in einen Sternenhimmel verwandeln.